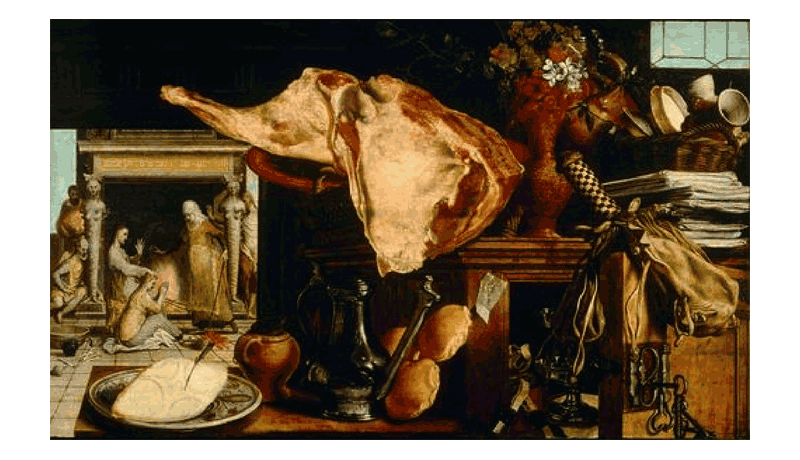Home - Christenheit - Zu einer Medientheorie des Monotheismus
|
|
Eckhard Nordhofen Kultbild - Schrift - Körper - Kunst Zu einer elementaren Medientheorie des Monotheismus Der folgende Vortrag wurde im Januar 2009 an der Universität Graz gehalten. Mit dem ersten Bild, lernen Sie die Manier des „langen Pieter“, kennen. Seine Lebenszeit 1508 oder 1509 bis 1575 fiel genau in die Zeit der Reformation in Amsterdam. Viele seiner frühen Werke wurden vom Bildersturm der Calvinisten zerstört. Wie wir wissen, hat der Ikonoklasmus in den Kirchen aber die Maler in den Niederlanden keineswegs arbeitslos gemacht. Es kam zu einer grandiosen Umbesetzung. Sie mutierten von Kirchenmalern zu Ausstattern von Gilde-, Zunft- und anderen repräsentativen öffentlichen Räumen, insbesondere aber produzierten sie für das wohlhabende bürgerliche Haus, fanden hier ihre Liebhaber, Kenner und Sammler. Amsterdam war im "goldenen Zeitalter", das nun begann, die reichste Stadt der Welt. Die Bilder bekamen einen neuen "Sitz im Leben". Die Verdrängung der Schilderkunst aus dem Sakralraum in die profane Welt der bürgerlichen Wohnung hat die Kunstgeschichte traditionell als Fortschrittsgeschichte erzählt. Zunächst weil die Umbesetzung zeitgleich mit bestimmten ästhetischen Entwicklungen stattfand, auch mit einer Zunahme von "Kunst" im Sinne von Können. Weil aber Fortschritt für ein bestimmtes Geschichtsbild auch das Verschwinden der Religion bedeutet, wurde dieser Wechsel regelmäßig im Rahmen der älteren Säkularisierungstheorie interpretiert, an die derzeit kaum jemand mehr glaubt. Wer wie Aertsen Stilleben malt, Marktszenen, Gemüse, Früchte, einen Fleischerladen, der scheint sich von himmlischen Sujets abgewendet zu haben. Da bleibt offenbar einer der Erde treu, da inszeniert er den Zauber des diesseitig Realen. Seine Kunst scheint in einer lustvoll illusionierenden Verdoppelung der Welt zu bestehen. Gegenstände, die man im Alltag vor Augen hatte, erscheinen im Bild noch einmal und je eher sie mit ihren dreidimensionalen Entsprechungen verwechselt werden können, umso höher scheint die Kunst des Künstlers veranschlagt zu werden. Das Tromp l`Œil wird alsbald zum Genre. Wenn Säkularisierung Abkehr von der Religion bedeutet, so wäre Aertsen freilich kein gutes Beispiel. Die Konversion vom Himmel zur Erde fand eher im Kopf des interpretierenden Kunsthistorikers statt als in dem von Aertsen. Fast regelmäßig finden sich nämlich auf einer zweiten Bildebene hinter den Stilleben biblische Szenen. Hier handelt es sich um den Besuch Jesu im Hause des Lazarus und um die Szene, in der sich Maria darüber beschwert, dass sie die ganze Arbeit alleine tun soll, weil Martha nur Zeit für Jesus und seine Lehren hat.
Nachdem der zweite Blick diese biblische Szenen „gelesen“ hat, gilt womöglich ein dritter Blick noch einmal dem Stilleben im Vordergrund, einem sehr merkwürdigen Arrangement von Gegenständen, die im Alltagsleben kaum je in dieser Zusammenstellung anzutreffen wären. In der Mitte prangt ein Lammschlegel. Um ihn fast schwebend im Zentrum des Bildes zu platzieren, ist eine ziemlich unwahrscheinliche komplizierte Stellage erforderlich. Darunter eine Weinkanne, drei Brote, ein Teller mit einem weißen Gebilde, in dem eine Nelke steckt. Brot und Wein, ein geschlachtetes Lamm sind eucharistische Bedeutungsträger. Die Samen der Nelke, die wir ja auch als Gewürz kennen, haben so ziemlich das Aussehen von handgeschmiedeten Nägeln, daher denn auch der Name der Blume „Näglein“ oder "Nelken". Auch das Blümchen ist also semantisiert. Es soll an die Nägel erinnern, mit denen Jesus ans Kreuz genagelt wurde. Sie zählen zu den Requisiten, die man als arma Christi kennt oder doch kannte. Ich will mich nicht in alle Einzelheiten einer dechiffrierenden Bildexegese verlieren. Ein geschlachtetes Lamm, Brot, Wein, das kommt nicht nur einem Kenner biblischer Texte bekannt vor. Wir können hier eine Bildrezeption unterstellen, die mit Doppelcodierungen arbeitete. Natürlich kann man in der auslegenden Decodierung auch ein intellektuelles Vergnügen oder eine eigene Kunst des Bilderlesens sehen, wie sie im Bilderrätsel oder Rebus später zum geselligen Zeitvertreib diente. Je mimetischer die Illusionskunst wird, desto mehr leitet sie dazu an, zunächst in den gemalten Dingen, dann aber auch in den nicht gemalten Gegenständen des Alltags, die der Betrachter in seiner Umwelt vorfindet, gleichsam zu „lesen“. Bilder dieser Art zeigen eine Welt "sprechender" Dinge. Was "sagen" sie uns? Den alten Topos, dass die Welt ein Buch ist, und dass es eine Kunst ist, in diesem Buch zu lesen, hat Hans Blumenberg in seiner opulenten Monographie „Die Lesbarkeit der Welt"(1981) nach vielen Seiten hin durchkonjugiert. Mit Säkularisierung hat diese religiöse Aufladung des Alltags in der Tat nichts zu tun. Aertsen hat die doppelte Chiffrierung nicht erfunden. Erwin Panofsky, der Promotor der "Ikonologie", spricht in seinem berühmten Werk "Early Netherlandish Painting" (1953) von einem "disguised symbolism", einer verkleideten Symbolik. Symbole wie die Lilie als Abzeichen jungfräulicher Reinheit gab es schon lange, fast möchte man sagen, schon immer. Das Wagenrad zu Füßen einer eleganten Heiligen auf dem Flügel eines gotischen Retabels liegt gewiss nicht zufällig herum, sondern identifiziert die Gestalt als heilige Katharina von Alexandria. Neu ist nicht die Symbolik sondern ihre Verkleidung. Semantisierte Dinge sind wie Texte, die es zu lesen gilt. Dass überhaupt die Dinge zu uns sprechen, ist auf eine anthropologisch tiefsitzende Disposition zurückzuführen. Wir haben ein antiphonisches Verhältnis zu unserer Umwelt. Dieser natürliche Wechselgesang zwischen Innen und Außen, zwischen Menschen und Dingen wird in der frühneuzeitlichen Malerei mit einer zweiten Bedeutungsebene unterlegt, die zunächst verborgen ist, dem Kundigen aber offenbar werden kann. Mit Jan van Eyck, Rogier van der Weyden und dem Meister von Flémalle (Robert Campin) und ihren Zeitgenossen hatte in den Niederlanden eine Malerei begonnen, die immer wegen ihrer Feinheit und ihrer akribischen Mimesis gerühmt worden ist. Ein hyperrealistischer Glanz umgibt sie. Sie amplifizieren die Sprache der Dinge über den Bestand konventionell semantisierter Symbole hinaus bis hin zu dem Anschein, überhaupt jedes Ding sei ein Bedeutungsträger. Auf den Bildern der frühen Niederländer treten wir ein in eine Welt, in der nahezu alle Dinge "sprechen". Sie dienen nicht der anekdotischen Staffierung, sie sind Bedeutungsträger. Panofskys Begriff der Ikonologie trifft den Punkt genau. Das Bild (Eikon) wird zu einem Wort/Logos-Äquivalent, das in die Welt der Wörter wie aus einer anderen Sprache übersetzt werden kann. Die Gegenstände sind weit über die Attribute, die wir von den Heiligendarstellungen des Mittelalters kennen, hinaus zeichenhaft aufgeladen. Es handelt sich um eine Spiritualisierung der Realien insgesamt. Natürlich entspricht dieser spirituelle Realismus nicht dem Säkularisierungsschema und ist in der kunsthistorischen Zunft umstritten. Otto Pächt, ein Vertreter der form- und stilgeschichtlichen Wiener Schule ist gegenüber der ikonologischen Methodolgie skeptisch. Der Streit der Fachleute darüber, wie weit die Decodierung getrieben werden könne, und ob wirklich alle Details eines Bildes umkehrbar eindeutig in propositionale Sprache übersetzt werden können, entspricht aber just dem Programm des frühneuzeitlichen Malers. Indem er eindeutig semantisierte Symbole der Tradition mit dem selben Realismus gibt, wie alle anderen Gegenstände seines Bildes, erzeugt er im Betrachter die Erwartung, dass schlechterdings alles für eine Deutung offen sei, ganz unabhängig davon, wie erfolgreich der Betrachter das Spiel vom Herausholen des Hineingelegten treibt. Er programmiert einen fragenden Blick, der alles auf Bedeutung hin absucht. Der nicht eindeutig semantisierte Überschuss an Realien steht offen für eine Deutung, die auch nicht unbedingt eindeutig übersetzt werden muss. Sie lädt ein zu einer latenten Referenz. Und mehr noch: da es sich ja um die Gegenstände der alltäglichen Umgebung handelt, wird das Bild zu einer Anweisung, auch die Lebenswelt außerhalb der Bilder mit einem sichtbar-unsichtbaren Bedeutungshintergrund zu sehen. Die Alterität des Sakralen, traditionell dem Kirchenraum zugeordnet, dringt nach dem Bildersturm in die Welt des Profanen ein. Dem entspricht das theologische Programm des Calvinismus, die reine Orthopraxie des Alltags, insbesondere die Arbeit, als Gottesdienst zu betrachten. Der durch solche Bilder Belehrte wird seine profane Umgebung mit einem spirituell einjustierten Blick betrachten. Statt dass die religiöse Dimension verschwindet, fermentiert sie das alltägliche Leben. Diese Umbesetzung der Alteritätsmarkierung scheint den alten Dualismus von sakral-profan zu kassieren und den Himmel auf die Erde zu holen. Sie erzeugt freilich ein neues Problem. Eine spirituell alltagsfromm gelesene Welt wird von einer nicht gedeuteten gottlosen ununterscheidbar. An solcher Kunst hat auch Freude, wer religiös unmusikalisch ist. Auch ein gottloser Kaufmann darf sich an den Früchten seiner Arbeit freuen und ein Stilleben betrachten, ohne fromme Doppelcodierungen zu knacken. Dies ist ein grundsätzliches Problem, das aber nicht für den langen Pieter gilt, denn der sichert sich gegen den gottlosen Blick auf die Sachen ab. Er zeigt den spirituellen Bezug unmissverständlich vor. Die biblischen Szenen im Mittelgrund bilden gleichsam ein missing link zwischen dem Medium der Schrift, der Heiligen Schrift der Bibel, in der die Szenen nachgelesen werden können, zum Lesen aus dem Arrangement der Gegenstände. Aertsen repräsentiert ein Zwischenstadium zwischen einer reinen spirituellen Aufladung der Gegenstände, die ohne einen definierten narrativen Kontext auskommen können, und einem Text aus dem Evangelium. Indem er gegen die Realitätskoordinate der Zeit absichtlich verstößt (das biblische Personal ist zwar altertümlich gewandet, agiert aber auf einer Bühne mit Zeitgenossen), behauptet er die Triftigkeit der Heiligen Schrift für die Gegenwart: Die biblische Szene, auf den zweiten Blick entdeckt, bildet den maßstäblichen Hintergrund des Alltäglichen. Unser Bild enthält noch eine besondere Pointe. Es gewinnt eine innere Spannung durch die Gegensätzlichkeit der Botschaften von Vorder- und Mittelgrund. Vorne regiert der calvinistisch spirituell aufgeladene Alltag. Im Mittelgrund ist die Alterität noch traditionell sakral markiert. Wir sehen, wie Jesus die von einem Strahlenkranz umgebene Martha segnet. Aus der alten attributiven Ikonologie der vorreformatorischen Kultbildtradition ist noch die Aura, ein Heiligenschein geblieben. Martha wird - so der Skopos unserer Perikope - dafür gepriesen, dass sie den Alltag sein lässt und sich Jesus und seiner Botschaft vom Anbruch des Reiches Gottes zuwendet. Zwei Wege der Alteritätsmarkierung sind simultan auf einem Bild vereint. Halten wir fest: Pieter Aertsen, der Mann, dessen Frühwerk dem Bildersturm zum Opfer fiel, ist der Repräsentant eines Medienwechsels, der sich innerhalb der Religionsgeschichte als Spezialität des calvinistisch-reformierten Zweiges der Reformation ergeben hat. Die konsequente und dezidierte neuerliche Hinwendung zum Medium der Schrift verbannte die Bilder aus dem Kirchenraum und bescherte ihnen ein goldenes Zeitalter in Bürger- und Herrenhäusern. An Pieter Aertsen können wir uns klar machen, dass die Bilder deswegen keineswegs religionslos geworden sind. Ihre Doppelcodierung belegt vielmehr die religiöse Aufladung des Alltags, der dann insgesamt unter religiösen Vorzeichen steht. Hans Belting hat 1990 mit seinem inzwischen als Klassiker geltenden Werk „Bild und Kult“ die Umbrüche der frühen Neuzeit noch im Rahmen der älteren Säkularisierungstheorie beschrieben, die inzwischen obsolet geworden ist. In seinen folgenden Werken insbesondere in „Das unsichtbare Meisterwerk“ (1998) und „Das echte Bild“ (2005) hat er die These, dass das Kultbild einem religiösen Mittelalter, zuzuordnen sei, während die Neuzeit je religionsloser und säkularisierter sie geworden sei, sich mehr und mehr dem Kunstbild zugewandt habe, selbst revidiert. Es war wohl auch weniger eine von ihm aufgestellte These, als die Suggestion des Untertitels von "Bild und Kult" der da lautete: „Eine Geschichte des Bildes vor dem Zeitalter der Kunst“. II Wenn es um einen Gegensatz von Kunstbild und Kultbild geht, so erscheint mir ein anderer Umbruch sehr viel eindrucksvoller zu sein. Springen wir einmal gut 700 Jahre zurück und wenden wir uns dem zweiten Konzil von Nikaia zu, das den großen Bilderstreit in Byzanz vorläufig beendete. Dieser hatte sich über viele Jahrhunderte hingezogen, im achten Jahrhundert besonders verschärft und war nun im Jahre 786 zu einer Entscheidung geführt worden, die in der orthodoxen Kirche bis heute als Fest der Orthodoxie begangen wird. Endgültig beendet wurde der Bilderstreit erst 835, aber auch hier sollten wir eher von einem vorläufigen Ende sprechen, denn der Bilderstreit brach, wie wir gesehen haben, in der Reformation erneut heftig aus und dauert im Grunde bis heute an. In Nikaia wurde den Bildern eine quasi sakramentale Aufladung zugesprochen. In der Tradition der platonischen Methexis-Lehre, nach der die empirischen Ideate zwar in kontingenter Materie hinter der Idee zurück stehen, aber doch einen Anteil an ihr haben, machen die Bilder des Heiligen, insbesondere die Bilder der Gottesmutter und das Bild Christi das Mysterium Gottes präsent und können daher selbst als heilig gelten. Ikonen werden „geschrieben“ nicht gemalt. Auf jeder Ikone muss auch Schrift aus Buchstaben erscheinen, die bezeichnet, um welches Sujet es sich handelt. Diese Regeln machen das Bild zu einem Parallelmedium, zur Heiligen Schrift. Lukas, Schreiber eines Evangeliums, "schrieb" in einer Parallelaktion nach der Legende die erste Ikone, das Bild der Gottesmutter mit ihrem Kind. Die Heiligkeit dieser beiden Medien ist offensichtlich abgeleitet von der Heiligkeit der Gegenstände, die sie zwar auf unterschiedliche mediale Weise - aber doch parallel - präsentieren. Als wir vor einigen Jahren in Frankfurt zum ersten Mal arabische Ikonen, das heißt Ikonen, die aus libanesischen und syrischen Klöstern stammten, einem Publikum vorstellten, kam zur Ausstellungseröffnung seine Seligkeit, der Patriarch von Damaskus. Zur Eröffnung klärte er das Frankfurter Publikum und die vielen Landsleute, die sich eingefunden hatten, über den richtigen Umgang mit Ikonen auf. Sie seien nicht Gegenstände einer kunstsinnigen Betrachtung, sie müssten vielmehr verehrt und geküsst werden. „Bitte nicht!“ rief mit spitzer Stimme die anwesende Kuratorin des Museums. Alles blieb friedlich. Aber den Gegensatz zwischen dem östlichen und dem westlichen Blick auf die Bilder hätte man nicht besser auf den Punkt bringen können. Sehr bald nach dem zweiten Konzil von Nikaia 786, nämlich im Jahr 794, fand in Frankfurt am Main das erste Konzil des lateinischen Westens statt. Als Veranstaltungsformat war es eine rivalisierende Nachahmung der östlichen Konzilien, inhaltlich der Versuch, eine Gegenposition in der Bilderfrage zu formulieren und zu befestigen. Hauptgegenstand war neben der Häresie des Adoptianismus der Horos, die Schlusserklärung des Konzils von Nikaia . In Frankfurt wendete man sich gegen die quasi-sakramentale Aufladung der Ikonen, die sich bis heute in der orthodoxen Kulttradition gehalten hat. Dort sind Bilder Medien der Gottespräsenz. Die Streitigkeiten beziehen sich eigentlich kaum auf die Faktur der Bilder, die Art und Weise, wie sie zu gestalten sind. Das ist deswegen kurios, weil in der Stilistik die eigentliche Antwort auf das Dilemma gefunden wurde, das sich aus dem Bilderverbot des Alten Bundes und den Konsequenzen der Inkarnation ergeben hatte. In dieser verfremdenden Stilistik der Ikonen, welche die veristischen Kunstgriffe der Lichtführung, Mimesis wie Schattenmalerei und anatomische Richtigkeit, wie sie in der Kunst der Spätantike Standard waren, hinter sich lässt, sehen wir heute eine bewusste Alteritätsmarkierung, die sich deutlich von dem mimetisch- illusionistischen Ideal der paganen hellenistischen Bildnerei absetzt. Obwohl die alteritäre Stilistik der Ikonen insofern zum Wesensmerkmal des Ikonenparadigmas wurde, ist sie aber nur am Rande zum Thema des theologischen Bilderstreits geworden. Sie hat ihren Niederschlag eher in den Regeln und Vorschriften für die Herstellung, das "Schreiben" von Ikonen gefunden. Der Streit geht im Wesentlichen um die Bildpragmatik und um die Art, wie mit Bildern umzugehen sei. Latreia oder Proskynesis, Anbetung oder Verehrung sind wichtige Distinktionen. In der Forschung hatte man eine Zeitlang den Streit zwischen Nikaia II und Frankfurt 794 auf Missverständnisse und verderbte Übersetzungen aus dem Griechischen ins Lateinische zurückgeführt. In der Tat lag der Frankfurter Synode nicht der griechische Urtext, sondern eine schlechte lateinische Übersetzung vor. Georg Thümmel kann aber überzeugend nachweisen, dass man sehr wohl wusste, worum es in Nikaia gegangen war. Die Frankfurter Gegenposition ist im Grunde die Bekräftigung einer römischen Tradition, die auf Gregor den Großen zurück geführt werden kann. Dieser hatte in zwei Briefen 599 und 600 an Serenus, den Bischof von Marseille, gegen dessen Bilderzerstörung Stellung genommen: „Dass Du sie zu verehren (adorari) verboten hast, dafür haben wir Dich durchaus gelobt, dass Du sie aber zerbrochen hast, haben wir verworfen… etwas anderes nämlich ist es, ein Bild zu verehren (adorare), und etwas anderes, durch das auf dem Bild Dargestellte zu lernen, was zu verehren (adorandum) sei. Denn, was den des Lesens Kundigen die Schrift, das bietet den schauenden Einfältigen das Bild, denn in ihm sehen die Unwissenden, was sie befolgen sollen, in ihm lesen die Analphabeten.“ Wenn wir uns an Hans Beltings Unterscheidung zwischen Kultbild und Kunstbild erinnern, so ist der von Gregor empfohlene Umgang mit Bildern kaum oder nur ansatzweise als kultisch zu bezeichnen. Bilder als Surrogat für die Schrift, die den Illiteraten nicht zugänglich ist, sind ein religionspädagogisches Hilfsmittel. Sie sind etwas Zweitbestes und nur in Ausnahmefällen Gegenstand der Verehrung. Hier ist eine wichtige Unterscheidung angebracht. Ein präsentatives Kultbild wie die Christusikone, ist eine Präsentation ohne einen bestimmten narrativen Kontext. Der Pantokrator, der Weltenherrscher, ist entrückt. Weltherrschaft ist machtvolle Präsenz, kein Einwirken. Wir sehen den Herrn der Geschichte, nicht ihren Agenten. Der Herrscher tut nichts, die Regierungsgeschäfte haben in ihm ihren legitimierenden Fluchtpunkt, sind aber deutlich von ihm unterschieden. Seine Präsenz ist reines Dasein. Einem solchen Bild kultische Verehrung zu erweisen, ist nachvollziehbar. Die Art und Weise, wie der Pantokrator in der Apsis den Kirchenraum byzantinischer Kirchen aber auch vieler romanischer Kirchen des Westens beherrscht, ist deutlich zu unterscheiden von narrativen Szenen, die als Illustrationen biblischer Texte schon sehr früh etwa in den Katakomben oder in den frühen Mosaiken von Santa Maria Maggiore in Rom anzutreffen sind. Ich schlage eine grobe Sortierung vor: Kultbilder sind präsentativ, Kunstbilder sind narrativ. Dies gilt freilich nicht in der Moderne. Der Streit um die Bilder bezieht sich im Wesentlichen auf Kultbilder, also präsentative Bilder, die Christus oder andere heilige Personen gegenwärtig setzen und zu einer interaktiven Symbolhandlung stimulieren, die dann Proskynesis oder Latreia heißen kann, Verehrung oder Anbetung. Narrativen Bildern Anbetung zu zollen, fällt den Gläubigen kaum einmal ein. Selbst wenn es sich um biblische, also heilsgeschichtlich bedeutsame Geschehnisse handelt, oder auch Wundergeschichten, sind sie doch kaum je so rezipiert worden, dass man vor ihnen auf die Knie fällt. Für den lateinischen Westen sind die Bilder, salopp gesagt, religionspädagogische Illustrationen, die schließlich in der Biblia pauperum zu kanonischen Sequenzen werden. Von der Spätantike bis in die Gegenwart hat es solche narrativ-illustrativen Bilder gegeben, die kaum als Kultbilder zu bezeichnen sind. Ein Zeitalter, wie das Mittelalter ausschließlich dem Kultbild zuzuweisen und das narrative Kunstbild als neuzeitlich-säkularisiertes Folgemuster auszuweisen, würde Hans Belting heute kaum mehr einfallen. In Nikaia ist freilich das Kultbild stark gemacht worden und Frankfurt hat dagegen Einspruch erhoben. Der westliche trennt sich vom östlichen Weg, ohne sich von Kultbildern entschlossen und radikal zu purifizieren. Bis in die neuzeitliche Verehrung von Gnadenbildern hält sich auch im Westen eine gewisse Kultbildtradition. Sie ist kaum einmal ein Thema der Hochtheologie und wird unter dem Titel "Volksreligion" oft in die theoretische Schmuddelecke verwiesen oder an die Ethnologen abgetreten. Sie ist auch für den Hauptstrom in der Entwicklung der christlichen Kunst kaum von Bedeutung. Das Nebeneinander von Kunstbild und Kultobjekt kennen wir übrigens schon aus der Antike. Hier gibt es neben einer bemerkenswerten Entwicklung, die schon von Duris von Samos in der Antike als Fortschrittsgeschichte der Kunst nachgezeichnet wurde, eine konstante kultische Verehrung von archaischen und präarchaischen Idolen. Während die Kunst von der harten und steifen Archaik (6. Jh.) (Gombrichs Worte) über Polyklet, der den Proportionskanon der menschlichen Figur entwickelt (5. Jh.) bis zu dem graziösen Praxiteles (4. Jh.) fortschreitet, werden an den Orakelstätten und in den Heiligtümern primitive Kultobjekte verehrt. Es ist also bei dem Versuch, Kultbilder und Kunstbilder bestimmten Epochen zuzuordnen, große Zurückhaltung geboten. Es fällt auf, dass die Weichenstellung von Frankfurt auch für die liturgische Praxis außerordentlich folgenreich gewesen ist. Das Heilige präsent zu machen, den unsichtbaren Gott des Alten und Neuen Testaments in die Mitte der Gemeinde zu holen - je weniger diese Aufgabe einem präsentativen Kultbild zukam, umso mehr rückt dann das im strengen Sinn bildlose Sakrament der Eucharistie ins Zentrum: der Leib Christi und die Reliquien, die Leiber der Heiligen. Nur im lateinischen Westen findet sich eine eigene eucharistische Tradition, die über die Messfeier hinaus reicht. In den östlichen Riten werden die konsekrierten Spezies von Brot und Wein in der Kommunion vollständig verzehrt, nicht aber aufbewahrt. Nur im lateinischen Westen bildet sich eine Tradition der Tabernakel und Sakramentshäuser heraus, nur hier wird bei der Wandlung den Gläubigen die weiße Scheibe der Hostie gezeigt, indem sie der Priester über seinen Kopf empor hebt und sie möglichst lange den Blicken aussetzt. Seine Arme müssen manchmal gestützt werden, damit der gnadenbringende Anblick den Gläubigen möglichst lange zuteil wird. Im späteren Mittelalter werden Monstranzen entwickelt, Zeigegefäße, die in eigenen Andachtsformen zur Aussetzung gebracht und zur Andacht dargeboten werden. Wir erleben derzeit eine Renaissance dieser Andachtsform. Das Fronleichnamsfest wird im 12. Jahrhundert eingerichtet und der Leib Christi in Gestalt einer Hostie in feierlichen Prozessionen durch die Städte und Dörfer getragen. Was sieht der Gläubige in diesen aufwendigen Inszenierungen? Eine weiße Scheibe. Er sieht, dass er eigentlich nichts sieht. Die Monstranz mit der weißen Brotscheibe in der Mitte ist die Inszenierung der Gottespräsenz bei gleichzeitiger visuellen Vorenthaltung des Gottesbildes, eine Folgewirkung des zweiten der Zehn Gebote auf neue, ungeahnte Weise. Ich verkneife mir hier einen Vergleich mit Malewitschs weißem Quadrat. III Nun ist es Zeit, über die Inkarnation zu sprechen, jener Station, die den großen Wechsel vom Gottesmedium der Schrift zum Gottesmedium Fleisch oder Mensch bezeichnet. Zur Vorbereitung auf diesen größten Medienwechsel des Monotheismus zeige ich Ihnen eine Szene, in der dieser Medienwechsel inszeniert wird. Es ist wiederum ein Bild des Langen Pieter, nach derselben Manier gegeben, die wir schon kennen.
Im Vordergrund sehen wir eine üppige Marktszene, aus der uns eine junge Frau mit traurig verschleiertem Blick anschaut. Im Schoß hält sie einen Krug, in den sie die Hand hinein gesteckt hat. Die Gefäße, die sie offenbar feil bietet, sind alle umgekippt. Schon meldet sich unser Verdacht auf Doppelcodierung. Die Forschung hat die Hand im Krug sexuell gedeutet. Warten wir ab, was der Blick in den Hintergrund erbringt. Wir sehen die dramatische Szene aus Joh 8, Christus und die Ehebrecherin. Pieter Aertsen wird sich mit seiner Übersetzung vom Text ins Bild als genauer Leser und als genialer Exeget erweisen. Er setzt ins Bild, was wir aus der Schrift kennen, und greift die Szene heraus, in der Jesus das einzige Mal im Neuen Testament selbst schreibt. Meist konzentriert sich die Aufmerksamkeit der Ausleger auf den wunderbaren Satz, den Jesus zu den Schriftgelehrten spricht: „Wer von euch ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein.“ In der Exposition der Szene geht es um die Schrift, das zentrale Gottesmedium der Tora. Es sind die Schriftgelehrten, die Jesus auf die Probe stellen wollen. Sie wollen austesten, ob Jesus die Dignität der Schrift anerkennt: „Mose hat uns im Gesetz vorgeschrieben, solche Frauen zu steinigen. Nun, was sagst du?“ Die „Antwort“ Jesu ist das, was ich eine Lehrperformance nenne. Die Bibel ist voll von solchen handlungssprachlichen Äquivalenten, die wir durchaus in propositionale Sprache übersetzen können. Hier seine handlungssprachliche Antwort: "Jesus bückte sich, und schrieb mit dem Finger auf die Erde." Genau diese Szene zeigt uns Pieter Aertsen. Dass diese Demonstration tatsächlich als Antwort Jesu aufzufassen ist, zeigt der Vers 7 wo es heißt: „Als sie hartnäckig weiter fragten…“ Sie geben sich mit dieser „Antwort“ also nicht zufrieden. Im Sinne des Erzählers ist es folglich eine solche gewesen. Dann richtet Jesus sich auf, sagt seinen wunderbaren Satz, bückt sich wieder und schreibt auf die Erde. Der schreibende Finger Jesu ist für Johannes nicht irgendein Finger. Es ist der Finger des Fleisch gewordenen Wortes, es ist für Johannes und seine Leser, die den Prolog (1,14) kennen, der Finger Gottes. Es ist also derselbe Finger, der schon einmal auf dem Sinai in die steinernen Tafeln die Tora geschrieben hatte. Was auf den Tafeln stand, konnte gelesen werden. War Gott schon selbst unsichtbar, so hatte er doch mit eigener Hand seine Schrift hinterlassen, die Schrift wurde damit zum Ort seines Willens, zum Ort der Gottespräsenz. Die Schrift wurde Heilige Schrift. Es versteht sich, dass wir gerne gewusst hätten, ob Jesus etwa den Vorschlag für eine Novellierung der Tora auf den Boden des Tempels, dort spielt die Szene, geschrieben hat. Hieronymus, Chrysostomus und Origenes spekulieren über mögliche Zitate aus dem Alten Testament. Damit wäre Jesus mit seinen Kontrahenten in eine Debatte eingetreten, wie sie unter Schriftgelehrten üblich war. Keine dieser Spekulationen kann überzeugen. Auch die aktuellen Kommentare tragen nichts bei, was wert wäre zu berichten. Vor allem ein Argument führt uns auf eine ganz andere Spur: Wenn wir den Inhalt dessen, was der göttliche Finger hier schreibt, hätten wissen sollen, dann hätte ihn uns der Evangelist wissen lassen. So aber schreibt er einfach auf den Boden "eis ten gen". Meine These ist, dass es sich tatsächlich hier um eine Szene handelt, die den Medienwechsel von der Schrift als Ort der Gottespräsenz zum fleischgewordenen Wort zum Thema hat. Das Wort vom Wort aus dem Johannesprolog vom Wort, das Fleisch geworden ist, ist Programm. Zunächst geht es natürlich um das Wort, das „im Anfang“ war und in Jesus dem Menschen Gestalt angenommen hat, dem Ersten der Entschlafenen. Aber Jesus ist ein Modell, das es gilt nachzuahmen, indem man ihn "aufnimmt". „Allen aber, die ihn aufnahmen, gab er Macht, Kinder Gottes zu werden…“ (1,12). Anders als die philologischen Exegeten hat Pieter Aertsen diesen Sinn genau verstanden. Er akzeptiert die Vorenthaltung des Evangelientextes, der uns nicht sagt, was Jesus geschrieben hat. Er hat offenbar verstanden, dass es Jesus und Johannes nicht um das Geschriebene sondern um die Schrift geht. Aertsens Lösung ist genial. Was Jesus auf den Boden schreibt, können wir lesen. Und was lesen wir? - Das hebräische Alphabet, Schrift als Rohmaterial, konkret aber sinnlos. Jesus schreibt also nicht irgend eine geheime Botschaft, die herausgefunden werden soll, sondern er schreibt Schrift, Lettern, keine Propositionen. So übersetze ich diese Lehrperformance als Plädoyer gegen die Verabsolutierung des Textes als Platzhalter Gottes. Gegen die aufgerufene Steinigungsvorschrift aus dem Gesetz des Mose zerschreibt Jesus die Schrift und depotenziert damit das gängige, bis dahin gültige Gottesmedium. Die Schriftgelehrten wussten intuitiv sehr wohl, dass Jesus etwas anderes wollte als sie. Manchmal redete er ja wie einer von Ihnen. Etwa in Mt 5 (Bergpredigt) soll kein Iota weggenommen werden von Gesetz und Propheten, dann aber heißt es: "Wenn eure Gerechtigkeit nicht größer ist, als die der Schriftgelehrten und Pharisäer, werdet ihr nicht in das Himmelreich kommen" (Mt 5,20) Unsere Szene Joh 8 ist wahrlich nicht die einzige, die den Medienwechsel von der Schrift zum Fleisch belegen müsste aber vielleicht die Schönste. Paulus bringt die Sache verschärfend auf den Punkt: "Der Buchstabe tötet, der Geist macht lebendig". (2 Kor 3,6) Eine Zwischenbemerkung zu meiner Vorgehensweise. Wie mit einer Suchlampe habe ich den Scheinwerferkegel auf drei Szenarien gerichtet, und hoffe, dass die in meiner Themenstellung aufgeführten Begriffe Ihnen in ihrem Zusammenhang deutlich geworden sind. Sie lauten: Kultbild, Schrift, Körper, Kunst. Ich hoffe, wir sind inzwischen soweit gekommen, dass Ihnen immerhin die (selbstverständlich ironisch gemeinte) Bemerkung von Hans Albert jetzt plausibel erscheint: „Alles hängt mit allem irgendwie zusammen.“ Nun möchte ich in einem diachronischen Durchgang durch die Religionsgeschichte des Monotheismus versuchen, aus dem „Irgendwie“ ein etwas systematischeres Wie zu machen. Dieser Durchgang wird nicht ohne Vereinfachungen und Vergröberungen auskommen. Wie also ist das Verhältnis von Kultbild und Schrift, von Schrift und Körper/Fleisch, und von allen diesen Medien zur Kunst zu sehen? Wenn ich im Folgenden nun von der biblischen Aufklärung rede, und damit den Durchbruch des Monotheismus in der von Karl Jaspers so genannten „Sattelzeit“ beschreibe, so wissen wir, dass dieser Quantensprung in der Religionsgeschichte keineswegs ein festes Datum hat. Einsichten haben immer etwas Plötzliches, etwas aufblitzend Einleuchtendes. Dass die Götter des Polytheismus bei näherer Prüfung allesamt sich als Verlängerungen menschlicher Bedürfnisse und Interessen entlarven ließen, diese Einsicht mag denen, die sie zuerst hatten, ebenso plötzlich gekommen sein. Wir stehen vor dem Kerngedanken eines in der Tat völlig neuartigen Gottesglaubens. Wenn es eine wirkliche Wirklichkeit namens Gott geben soll, muss es ein Gott sein, der nicht selbstgemacht ist, der seine Existenz nicht meinen Hoffnungen, Sehnsüchten und Wünschen verdankt. Die Rede von einem Gott, der ein Gegenüber ist, also nicht das Produkt meiner Projektionen und Spekulationen, ist nur dann sinnvoll, wenn er es ist, der sich offenbart. Wir kennen die narrative Fassung dieser Einsicht, aus Ex 3, der Szene vom Dornbusch, der brennt und nicht verbrennt, und der Offenbarung des Tetragramms JHWH. Das pure Ich-bin-da, die reine Anwesenheit, duldet keine weiteren Bestimmungen neben sich. Dieser Gott hat, außer dass er da ist, zunächst keine Funktionen. Sein pures Dasein ist wie ein Vorzeichen vor der Klammer, die die Welt bedeutet. Die Offenbarung dieses Daseins wird als Zuwendung erfahren. Er ist jemand, der sich mir offenbart, weil er mit mir etwas vor hat, mit mir, Mose, in Verbindung treten will, weil er mich und nicht nur mich alleine, sondern mein Volk, die Menschen, liebt und befreien will. Der Gott, der keine Funktionen hat, außer dass er für mich, für uns, da ist, ist anders, oder wie Rudolf Otto und Paul Tillich formulieren: „Der ganz Andere.“ Diese Andersheit ist eine negative Bestimmung. Eine privative Negation, wie die Logiker sagen. Wer alle inhaltlich-funktionalen Bestimmungsgründe wegnimmt (privatio = Beraubung) landet beim nackten Dasein: "Ich bin da". Das war in der Tat neu und anders. Anders als was? Anders als die Götter, deren Zwecke die Liebe, die Fruchtbarkeit, das Kriegsglück, das kollektive Ego einer Ethnie etc. sein mag. Der Modus einer solchen Offenbarung ist die Gleichzeitigkeit von Anwesenheit und Entzug. Mose will einen Namen wissen. Ein Name zielt immer auf die differentia spezifica eines Individuums. Ein Name dieser Art wird ihm auf erhellende Weise vorenthalten. Wenn man so will, ist das Tetragramm, also JHWH, ich bin der "Ich-bin-da", das Gegenteil eines Namens - als Name. Nun sagen uns die Alttestamentler, dass sich diese Einsicht oder Eingebung, je nach Blickrichtung, keineswegs exaiphnes abgespielt haben dürfte, sondern in Stufen. Ein langsamer Prozess vom Plural zum Singular, vom Polytheismus zum radikalen Monotheismus wird uns historiographisch vor Augen gestellt. Elohim, der in manchen Texten wie ein Synonym von Jahwe gebraucht wird, z. B. in der Geschichte von der Bindung Isaaks, enthält noch einen verräterischen grammatischen Plural. Dann wird Jahwe für längere Zeit als ethnozentrischer Bundesgenosse rekonstruiert. Von einer Jahwe-Allein-Bewegung ist die Rede. Diese Rekonstruktionen werden aber, wie ich finde, durchaus legitimerweise in der gegenwärtigen Monotheismusdebatte zu einem klaren Gegensatz kondensiert: Monotheismus versus Polytheismus. Jan Assmann spricht etwa von der „mosaischen Entgegensetzung“ oder später von der „mosaischen Unterscheidung“. Für die ausgereifte, nachexilische Fassung des Monotheismus können wir also tatsächlich von einem andersartigen Gott reden, der mit den Worten des Propheten Jesaja von sich sagt: „Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und meine Wege sind nicht eure Wege.“ (Jes 55,8) Anwesend, aber unkalkulierbar, nahe, hautnahe, und doch fremd. Eine besonders schöne narrative Fassung, die wieder etwas von einer Lehrperformance hat, ist die gespenstische, von Thomas Mann in seinem Josefsroman kongenial nacherzählte Szene von Jakobs Kampf am Jabbok. Ein "Mann“, ein Fremder, tritt in einer passageren Szene, dem Übergang von einem Ufer auf das andere, dem "Gotteskämpfer" Israel entgegen (Gen 32,25-33). Jakob erhält am Ende der Szene diesen neuen Namen. Wer hat Gewalt über wen? Ein Ringkampf soll dies klären. Die leibliche kämpferische Umschlingung endet mit einer Bitte um Segen: „Ich lasse dich nicht los, wenn du mich nicht segnest.“(32,27) Die Gottesnähe kann kaum größer gedacht werden, als ein solcher Clinch mit Gott. Jakob will wissen, wer ihm da so nahe gekommen ist, und fragt nach dem Namen. Diese Frage wird ihn streng verwiesen: „Was fragst du mich nach meinem Namen!“ Stattdessen erhält Jakob selber den Namen Israel, Gotteskämpfer. Uns, als den Lesern und Hörern dieser Geschichte, klärt er darüber auf, um wen es sich gehandelt hatte. Auch der aitiologische Flurname „Penuel“ gibt diese Auskunft: „Gottesgesicht“. Aber hat Jakob den Fremden wirklich erkannt, hat er ihn wirklich gesehen? Am Ende des Johannesprologs (1,18) wird es heißen: „Keiner hat Gott je gesehen“. Der Kampf fand im nächtlichen Dunkel statt, er endete abrupt in dem Moment, wo es hell wird. Jakob wird gezeichnet. Er erhält ein körperliches „Andenken“, einen Schlag auf die Hüfte, der ihn fortan hinken lässt. Gottesnähe ist gefährlich. Diese Lehrperformance ist ein starkes Gegenmittel gegen die Tendenzen, den lieben Gott allzu lieblich als Himmelsbild des Gutmenschen zu zeichnen, die wir manchmal in der Religionspädagogik für Kinder beobachten. In den Offenbarungsgeschichten, den Lehrperformances der hebräischen Bibel mühen sich die Erzähler um die Dialektik von Nähe und Entzug. „Lass mich doch dein Angesicht sehen“ - so spricht Mose in Ex 33,18. Der Bitte wird so entsprochen, dass klar wird, dass sie illegitim ist. Mose wird in einen Felsspalt gestellt, während die Herrlichkeit des Herrn vorüberzieht, und der Herr selbst hält in einer etwas komplizierten Choreographie dem Mose die Hand vor die Augen. Erst als er schon vorüber ist, am Ende der Passage, darf Mose den Rücken sehen. Wenn wir solche Lehrperformances in diskursiven Klartext zu übersetzen versuchen, dann merken wir, dass die Narration reicher ist als etwa die Rede von Entzug und Nähe von Passage und Gegenwart. Der Diskurs müsste herausstellen, dass die formgeschichtliche exegetische Deutung genauso wie die strukturale und philosophische Rekonstruktion kaum alles erfassen kann, was solche Offenbarungserzählungen enthalten. Sie sind etwas radikal anderes als die Chronik der laufenden Ereignisse. Überhaupt ist es jene Andersheit, jene Alterität, um die es den Gottestexten zu tun ist. Es geht um die Markierung von Alterität. Das ist das tiefste Grundpensum der monotheistischen Theologie und der Ausgangspunkt seiner Mediengeschichte. Hierin unterscheidet sie sich auch von den Mythen, in denen das himmlische Personal der olympischen Götter genauso wie Götter des Zweistromlandes oder Ägyptens auftreten. Im Prinzip treten sie so auf, wie Zeus und Hermes in Kleists Komödie „Amphytrion“. Die Götter nehmen zwar die Gestalten von Amphytrion und Sosias an, so wie Zeus auch die Gestalt eines Schwans oder eines Stiers annehmen kann, aber es sind Ereignisse, die in den mythischen Erzählungen so vor die inneren Augen der Zuhörer gestellt werden, wie eine Videokamera sie als empirische Ereignisse abbilden würde, wenn das Gedankenexperiment erlaubt ist. Alteritätsmarkierung ist das zentrale Medienpensum und auch das zentrale Medienproblem des Monotheismus. Wie kann die Alterität in das radikal Andere, des ganz Anderen so präsentiert werden, dass seine Unverwechselbarkeit mit den laufenden Ereignissen, in einer Welt, die ist, wie sie ist mit ihren empirischen Tatsachen, gesichert ist? IV Die biblische Aufklärung hängt eng mit einem damals neuen Medium zusammen. Es ist das Medium der Schrift. Für eine Mediengeschichte des Monotheismus, wie ich sie im Sinn habe, ist der scriptural turn eine entscheidende Voraussetzung. Was unterscheidet das Medium Schrift von dem Medium des Kultbildes? Ein Kultbild wie das Goldene Kalb, um das die Kinder Israels herumtanzen (Ex 32), kann wie alle Kultbilder seine Genese vergessen machen. Wir kennen aus Mesopotamien Ableugnungsrituale, in denen die Verfertiger von Götterbildern vor das Publikum treten, und beteuern mussten, dass sie mit der Herstellung der Götterbilder nichts zu tun haben. Götterbilder müssen vom Himmel gefallen sein, acheiropoieta sein, nicht von Menschenhand gemacht. Die Verselbständigung des Kunstwerks ist ein Phänomen, das wir am schönsten in dem kleinen Mythos von Pygmalion beschrieben finden. Noch gerade hatte der Künstler Pygmalion Hand an sein ideales Frauenbild gelegt, als es ihm wie etwas Neues und Fremdes entgegen trat. In etwas, das seiner eigenen Hände Arbeit entsprungen war, hätte er sich kaum verlieben können. Wie mit einem plötzlichen Kick blickt ihn die Figur, die er doch selbst gemacht hatte, an, so dass er sich in sie verliebt. Viele Künstler kennen diesen Effekt, dass das, was sie gerade machen, plötzlich eine innere Eigendynamik entwickelt, etwas von ihnen will, wie ein echtes Gegenüber. Mimetische Kunst muss nicht die Welt verdoppeln, aber sie ist immer durch den Golem-Effekt bedroht. Plötzlich fängt die Puppe, die Gepetto geschnitzt hatte, an zu sprechen und Pinocchio ist lebendig geworden. So lädt die Repräsentation der Götter durch Bilder und Bildnisse geradezu dazu ein, diese Bildnisse mit dem zu verwechseln, was sie am Anfang doch nur bedeuten sollten. Der kalte Blick ist daneben immer möglich, wie uns das Xenophanes-Fragment beweist, demzufolge die Götter der Thraker blauäugig und blond und die der Äthiopier stumpfnasig und schwarz sind, und wenn die Tiere, Hände und Werkzeuge hätten, würden sie sich Götter nach ihrer eigenen Gestalt machen. Diese Medienkritik ist eine Entlarvung der kultischen Praxis, bei der Israel aber nicht stehen bleibt, weil es das neue Medium der Schrift nutzen kann. Unter dem Titel scriptural turn erfasst die Religionswissenschaft diesen Medienwechsel. Jan Assmann spricht von einem Wandel des Mediums, aber es ist mehr als ein Wandel, es ist ein bewusster Medienwechsel. Unter der Überschrift „scriptural turn“ versuchen die Religionsgeschichtler die Wende vom Kultbild zur Schrift zu fassen. Schon Moses Mendelssohn formuliert: „Mich dünkt, die Veränderung, die in den verschiedenen Zeiten der Kultur mit den Schriftzeichen vorgegangen, habe von jeher an den Revolutionen der menschlichen Erkenntnis überhaupt und insbesondere an den mannigfachen Abänderungen ihrer Meinungen und Begriffe in Religionssachen sehr wichtigen Anteil“ . Jan Assmanns „scriptural turn“ betont nicht nur den Übergang von der Bilderschrift zur Buchstabenschrift, den schon William Warburton und Giambattista Vico bemerkt hatten, sondern vor allem den Übergang von Mündlichkeit zur Schriftlichkeit. Für die Religionswissenschaft ist der Übergang von Kultreligionen zu Buchreligionen oft auch systematisch besetzt und mit den Begriffen Primär- und Sekundärreligion belegt. Mir geht es heute nicht um Klassifizierungen, sondern um die grundsätzlichen Möglichkeiten, die im neuen Medium Schrift enthalten sind. Was ist neu? Was ist anders? Ein Bewusstseinsinhalt, der seine Präsenz ausschließlich der fixierten Sprache im Medium der Schrift verdankt, ist auf seltsame und einzigartige Weise anwesend und abwesend zugleich. In der Schrift entsteht ein eigener ontologischer Modus, eine besondere Art da zu sein. Ein Gegenstand aus einer primären Welt der Natur, wird er durch sein Bild re-präsentiert, unterscheidet sich in seinen Auswirkungen kaum von diesem. Eine appetitliche Frucht kann den Speichelfluss genauso anregen, wie ihre Abbildung. Daher ist die Verwechselung eines Bildes mit dem, was es darstellt, immer eine naheliegende Gefahr. Der Tromp l'Œil-Effekt ist das ganze Vergnügen einer Ästhetik der Mimesis, ein dekonstruktivistisches Spiel von Illusionierung und Entlarvung. Die religiöse Praxis in der Entstehungsphase des biblischen Monotheismus, das magische Aufladen von Fetischen und Kultbildern, wird ein Gegenstand aufklärerischer Entlarvung. Das Bedürfnis nach einem belebten Gegenüber, einem Partner für Wechselwirtschaft und Tausch, für ein illusionäres Einwirken, dort wo die eigene Macht eigentlich schon aufgehört hat, ist offenbar in der menschlichen Natur angelegt, wird aber von der Vernunft durchschaut und entkräftet. Diese Entmächtigung des alten Mediums ist erst möglich, wenn ein neues Medium zur Verfügung steht, das darstellen kann, ohne Anwesenheit zu simulieren und zur Verwechslung einzuladen. Diese Aufklärung, welche die Religionswissenschaft mit der Sekundärreligion in Verbindung bringt, und die von Jan Assmann, einem Sigmund Freud'schen und Thomas Mann'schen Sprachgebrauch folgend als „Fortschritt der Geistigkeit“ bezeichnet wird, ist in der Tat als Qualitätssprung in der Religionsgeschichte zu verbuchen. Der Gott des alten Israel, die Grundkraft des Universums, der Schöpfer des Alls, ist kein Ding in der Welt, er ist ihr Gegenüber. Diese ontologische Singularität drückt sich in seinem „Namen“ aus, der kein Name ist, sondern der ausgezogene Endpunkt einer Abstraktionslinie: Ich bin der „Ich bin da“. Dieses reine Dasein ist, wenn man es mit dem seienden einzelnen Ding vergleicht, entweder ein Nichts oder das genaue Gegenteil, die omnitudo realitatis. Die Tora genießt eine dem Kultbild vergleichbare aber dennoch ganz andersartige Verehrung. Zunächst wird sie im kostbaren und mobilen Gefäß der Bundeslade aufbewahrt. Dann im Tempel, sonst Ort von Kultbildern. Dieser ist dann als kostbarer Schrein des Vermächtnisses neu konzipiert. Aber nicht der Tempel ist der Ort Gottes, sondern das, was er einhaust, die von Gott selbst geschriebene Schrift. So werden die ersten fünf Bücher der hebräischen Bibel, zu denen später die prophetischen Bücher treten, zum Ort Gottes, zur Heiligen Schrift, die messianische Qualität besitzt. Die Schrift, in der Gott sich offenbart, gibt ihn dennoch nicht in die Hand der Schriftkundigen. Es ist das Medium selber, das die Differenz, den Abstand garantiert, den jeder Begriff von dem Gegenstand hat, auf den er sich bezieht. Mit diesem Medium der Differenz kann Gott sich offenbaren, in dem er doch verborgen bleibt und sich entzieht. Theodor W. Adorno spricht in der „Negativen Dialektik“ vom nicht-identischen Rest. So weit reicht die Spur der biblischen Aufklärung, in dem das Modell Offenbarung als Bestreitung das Mysterium installiert. Der nächste und entscheidende Medienwechsel ist im Neuen Testament mit dem Namen Jesus verbunden. Unnachahmlich und pointiert bringt Johannes ihn in seinem Wort vom „Wort“ auf den Punkt, vom Wort, das im Anfang bei Gott war, das Gott selber ist, das schließlich Fleisch geworden ist und unter uns gezeltet hat. Diese Inkarnation, d. h. Fleischwerdung, wird auf zuerst Jesus bezogen. Die lukanischen Kindheitsgeschichten geben die Langfassung in narrativer Form. Jesus ist der Sohn Gottes. Diese Sohnschaft Gottes macht den singulären Rang der Figur Jesus aus, wie ihn das Konzil von Chalcedon später in seiner Lehre von den zwei Naturen Jesu, der göttlichen und menschlichen, die paradoxerweise unvermischt aber auch ungetrennt zusammen gehören, zum Ausdruck bringt. Diese singuläre Stellung kommt Jesus als dem Christus auch deswegen zu, weil er das erste Beispiel dieses zweiten Medienwechsels liefert, das erste Beispiel, aber nicht das einzige und nicht das letzte. Was vor dem 14. Vers des Johannesprologs steht, wird gerne überlesen. Es ist nämlich nicht Jesus alleine, der als Ort Gottes ausgerufen wird. Alle nämlich haben die „Macht, Kinder Gottes zu werden, allen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus dem Blut, nicht aus dem Willen des Fleisches, nicht aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind“ (1,13). Um es einfach zu sagen: der Mensch kann zum Ort Gottes werden. Hier gibt es natürlich sofort Klärungsbedarf. Schon das Buch der Entstehung, Genesis, klärt die Stellung des Menschen in der Welt, vor allem, dass er nicht gottgleich ist. Er ist ein Geschöpf Gottes, und er ist aus dem Paradies vertrieben, weil er ein Sünder ist. Die Frucht vom Baum der Erkenntnis, d. h. das Wissen um das, was gut und böse ist, kommt ihm nicht zu. Er machte von seiner Freiheit einen falschen Gebrauch, aber er hatte den Atem Gottes empfangen, einen belebenden Geist, der ihn zum Mitschöpfer machte, zum Adam, der neben dem Schöpfer stand und den Tieren Namen geben durfte. Der Mensch, das zoon logon echon, das Tier das Sprache hat, ist zwischen seine animalische Tierähnlichkeit und seine Gottähnlichkeit eingespannt und setzt sich ins Verhältnis zu Gott und der Welt. Das Gottesmedium Schrift kann eine naheliegende Phantasie auslösen. Wenn Gott schon unsichtbar und kein Ding in der Welt ist, so kann ich seinen Willen dennoch erfahren, indem ich das entziffere, was er zu meiner Instruktion in die Welt gesetzt, ja sogar mit eigenem Finger in die Tafeln der Bundesurkunde geschrieben hat: Die Schrift. Die Schrift als Platzhalter Gottes muss also studiert und das, was sie vorschreibt, als Weisung befolgt werden. Das orthodoxe Judentum steht bis heute in dieser Tradition der lebenspraktisch wirksamen Schriftgelehrsamkeit. Die Schrift studieren, auch den Kommentar und den Kommentar zum Kommentar, Mischna, Talmud - diese scharfsinnige Schriftgelehrsamkeit, hat erstaunliche Leistungen vollbracht. Orthodoxe Juden bringen es fertig, in der modernen Welt zu leben und im eifrigen Fortschreiben und Studieren dennoch die Gültigkeit der Tora lebensförmig zu halten. Jakob Neusner, der Rabbiner, auf den sich Benedikt XVI. in seinem Jesusbuch bezogen hat, verdeutlicht in seiner Replik „Einzigartig in 2000 Jahren“ seinen Standpunkt noch einmal mit wünschenswerter Klarheit: „Wir hingegen halten dafür, dass die Tora vollkommen war und ist, über jegliche Verbesserung erhaben, und dass das Judentum, das auf der Tora und den Propheten und den Schriften gründet, sowie auf den ursprünglich mündlich überlieferten Teil der Tora, die in der Mischna, im Talmud und im Midrasch niedergeschrieben sind, Gottes Wille für die Menschheit war, ist und bleibt“. Das Judentum vollführt, wie George Steiner einmal formuliert hat, einen „Tanz des Wortes vor der halb geöffneten und halb geschlossenen Bundeslade des Wortes“. Jesus ist nicht nur im Blick des Johannesevangeliums das große Beispiel eines Medienwechsels von der in Inlibration zur Inkarnation, von der Schrift zum Menschen selbst, er propagiert und inszeniert ihn auch in seinen Streitgesprächen und Beispielen, die er in der Auseinandersetzung mit den Schriftgelehrten vorführt. Oft redet er selbst wie ein solcher. „Kein Jota soll von Gesetz und Propheten weggenommen werden“ (Mt. 5,18), aber „wenn eure Gerechtigkeit nicht weit größer ist als die der Schriftgelehrten und Pharisäer, werdet ihr nicht in das Himmelreich kommen“ (5,20). Er respektiert die Tora, will sie aber überbietend zur Vollendung führen. Wenn der Medienwechsel von der Inlibration zur Inkarnation, vom Konzept der Schrift als Ort Gottes zum Konzept des Menschen als Ort Gottes gelingen soll, hängt alles davon ab, ob der Übergang vom paradigmatisch fleischgewordenen Wort Jesus, zu allen anderen Menschen gelingt. Das Ereignis einer Inkarnation, die mit 33 Jahren Lebenszeit eine höchst überschaubare Episode geblieben wäre, verlangt nach Übertragung und Verlängerung. Die dogmatische Entwicklung der Konzilien und des Selbstverständnisses der Kirche, jedenfalls der katholischen und der orthodoxen Kirche, ist dem Problem gewidmet, das sich im Johannesevangelium im Wort vom „bleiben“ manifestiert. Wenn in Jesus sich die Möglichkeit offenbart, dass Gott in seinem Sohn und in seinen Kindern wohnen kann, dass das Wort Fleisch werden konnte, dann ist es eine buchstäbliche Überlebensfrage der Kirche, wie aus einer Episode von 33 Jahren ein fortdauerndes bleibendes, ja überzeitliches Heilsereignis universaler Natur werden kann. Es ist die eucharistische Tradition, die das endgültige Medium der Inkarnation und eine sakramentale Semantik entwickelt. Der Leib Christi, der sich mit dem Leib der anderen Kinder Gottes, die seiner Spur folgen wollen, in der Kommunion vereinigt, eröffnet die Möglichkeit einer fortdauernden Anwesenheit des Christus, der nicht im Tod geblieben, sondern auferweckt worden ist. Jesus selbst hat im Rückgriff auf die Exodustradition das ungesäuerte Brot und den Wein, den die Kinder Israels zur Erinnerung an die Befreiung aus dem Sklavenhaus alljährlich am Sederabend konsumieren, in einer zweiten Semantisierung mit einem starken neuen Sinn versehen. Indem er sich mit dem Brot der Freiheit identifiziert, gibt er den Zwölfen, welche die zwölf Stämme Israels repräsentieren, zu verstehen, dass er bleiben wird über seinen bevorstehenden Tod hinaus. Er wird bleiben in dem Zeichen des ungesäuerten Brotes und des Weines, in dem Gedächtnismahl, in dem die Christen seine Gegenwart aufrufen, ihn nicht nur symbolisch anwesend sein lassen, ihn vielmehr in der Kommunion sich einverleiben, um mit ihm eins zu werden.
|