Ulrich Greiner
Gedenkblatt für Wolfgang Mattheuer zum 80. Geburtstag
Der Maler Wolfgang
Mattheuer wurde am 7.4.1927 in Reichenbach/Vogtland geboren und starb am 7.4.2004 in Leipzig
 Wolfgang Mattheuers Bild Alter Genosse am Zaun (1971) zeigt nur scheinbar eine Idylle. Demonstrativ selbstzufrieden lehnt der Mann auf seiner Gartenpforte und blickt frontal auf den Betrachter, während hinter ihm, im ersten Stock des etwas entfernt stehenden Hauses, eine weitere Person, vermutlich seine Frau, in der nämlich Pose auf der Fensterbank lehnt. Das Bild strahlt einen satten Feierabendfrieden aus. Das Auffällige ist aber der Zaun. Er füllt den ganzen Vordergrund aus und ist so hoch, dass man sich des Gefühls nicht erwehren kann, der Mann sei eingesperrt – oder er habe sich selber eingesperrt. Dieses Gefühl wird durch die Brücke verstärkt, die quer durch das Bild schneidet. Ihre Bögen sind weiß eingefasst, so dass auch die Brücke wie ein Zaun wirkt. Sogar die Kanten des Gebäudes in der Mitte haben diesen weißen Rand, wodurch sich der Eindruck des Eingekästelten, Eingehegten noch einmal steigert.
Wolfgang Mattheuers Bild Alter Genosse am Zaun (1971) zeigt nur scheinbar eine Idylle. Demonstrativ selbstzufrieden lehnt der Mann auf seiner Gartenpforte und blickt frontal auf den Betrachter, während hinter ihm, im ersten Stock des etwas entfernt stehenden Hauses, eine weitere Person, vermutlich seine Frau, in der nämlich Pose auf der Fensterbank lehnt. Das Bild strahlt einen satten Feierabendfrieden aus. Das Auffällige ist aber der Zaun. Er füllt den ganzen Vordergrund aus und ist so hoch, dass man sich des Gefühls nicht erwehren kann, der Mann sei eingesperrt – oder er habe sich selber eingesperrt. Dieses Gefühl wird durch die Brücke verstärkt, die quer durch das Bild schneidet. Ihre Bögen sind weiß eingefasst, so dass auch die Brücke wie ein Zaun wirkt. Sogar die Kanten des Gebäudes in der Mitte haben diesen weißen Rand, wodurch sich der Eindruck des Eingekästelten, Eingehegten noch einmal steigert.
Der Himmel aber, der gut die Hälfte des Bildraumes einnimmt, öffnet keine befreiende Perspektive, denn er ist verhangen, von tonig matter Farbe. Von dort oben kommt nichts. Die einzige Bewegung in dieser erstarrten Szenerie vollziehen Autos, die man auf der hoch über das Tal hinwegführenden Brücke erahnen kann, aber sie fahren rechts und links aus dem Bild hinaus, und der Mann wirkt keineswegs so, als wollte er sich ihnen anschließen. Im Gegenteil: Er scheint mit seiner Lage höchst einverstanden. Er hält übrigens etwas in den Händen, was wie ein Brief aussieht, und in der Tat befindet sich links am Zaun ein kleiner Briefkasten. Vielleicht hat er den Brief gerade herausgenommen. Er scheint keine schlechte Nachricht zu enthalten.
Das Bild wurde in einer Zeit gemalt, da die DDR noch in voller Scheinblüte stand, und man könnte es nach seiner politischen Botschaft befragen, die damals 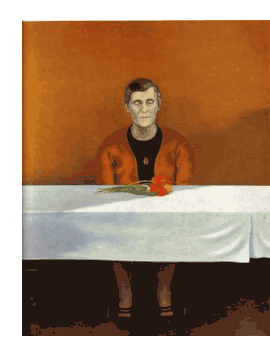 vielleicht intendiert war oder die man darin lesen konnte. Aber die Stärke von Mattheuers Bildern beweist sich eben darin, dass sie weit über den Anlass hinausgehen und vieldeutig sind, wie es große Kunst in der Regel zu sein pflegt. Es ist zum Beispiel nicht klar, ob das berühmte und berüchtigte Bild Die Ausgezeichnete (1973), das auf der Dresdener Bezirksausstellung für Furore sorgte, ein erfülltes Leben zeigt oder ein gescheitertes. Klar ist nur, dass die verhärmte, ältere Frau, die geistesabwesend-entrückt auf einen Tulpenstrauß niederblickt, allein ist und dass das messerscharf gespannte Tischtuch den Betrachter von ihr trennt und seine Frage nach dem Glück dieser Gestalt ebenso naheliegend wie unangemessen macht. Und was bedeutet es, dass ein johlender Touristenbus durchs Gebirge fährt, während vorne jemand abgestürzt auf dem Rücken liegt, die Federflügel in Trümmern um sich herum (Ein seltsamer Zwischenfall, 1991)? Der Betrachter wird sich vielleicht daran erinnern, dass die ungarischen Busse, die im Ostblock, ob in Minsk oder in Alma Ata, ihren Dienst taten, Ikarus hießen. Aber hilft das weiter?
vielleicht intendiert war oder die man darin lesen konnte. Aber die Stärke von Mattheuers Bildern beweist sich eben darin, dass sie weit über den Anlass hinausgehen und vieldeutig sind, wie es große Kunst in der Regel zu sein pflegt. Es ist zum Beispiel nicht klar, ob das berühmte und berüchtigte Bild Die Ausgezeichnete (1973), das auf der Dresdener Bezirksausstellung für Furore sorgte, ein erfülltes Leben zeigt oder ein gescheitertes. Klar ist nur, dass die verhärmte, ältere Frau, die geistesabwesend-entrückt auf einen Tulpenstrauß niederblickt, allein ist und dass das messerscharf gespannte Tischtuch den Betrachter von ihr trennt und seine Frage nach dem Glück dieser Gestalt ebenso naheliegend wie unangemessen macht. Und was bedeutet es, dass ein johlender Touristenbus durchs Gebirge fährt, während vorne jemand abgestürzt auf dem Rücken liegt, die Federflügel in Trümmern um sich herum (Ein seltsamer Zwischenfall, 1991)? Der Betrachter wird sich vielleicht daran erinnern, dass die ungarischen Busse, die im Ostblock, ob in Minsk oder in Alma Ata, ihren Dienst taten, Ikarus hießen. Aber hilft das weiter?
Mattheuers Unglück, wenn man es einmal so zuspitzen darf, bestand ja eine Zeitlang darin, dass man ihn immer als DDR-Maler betrachtet hat. Was bedeutete, 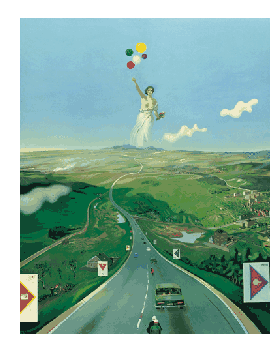 dass er zu Lebzeiten der DDR wegen seiner dissidentischen Qualitäten gelobt wurde. Am sichtbarsten wurde das in der Ausstellung, die Uwe Schneede 1977 im Hamburger Kunstverein arrangierte und wo das Bild Hinter den sieben Bergen eine prominente Rolle spielte. Man verstand es als Verbeugung vor dem Freiheitskampf des Prager Frühlings, was sicherlich keine falsche, aber doch eine sehr verkürzte Deutung ist. Als dann aber die DDR verschied, war dieser dissidentische Bonus erschöpft, und die Maler der so genannten Leipziger Schule konkurrierten nun auf dem freien Markt mit den dort etablierten Künstlern der Westkunst. Das ist der Hintergrund, vor dem es 1994 zum deutschen Bilderstreit kam. Dieter Honisch, Direktor der Berliner Neuen Nationalgalerie, hatte Bilder von Willi Sitte, Werner Tübke, Bernhard Heisig und Wolfgang Mattheuer in eine neue Präsentation gegenwärtiger Kunst aufgenommen und damit Protest geerntet. Er kam von CDU-Mitgliedern des Abgeordnetenhauses, aber auch von Kunstfreunden und Kunstkritikern. Der Vorwurf: Damit werde die Staats- und Auftragskunst der DDR unzulässig nobilitiert, diese Bilder des „Agitprop“ würden „aus ihrer DDR-Geschichtlichkeit entlassen“ – so Hans-Joachim Müller in der ZEIT vom 20. Mai 1994. Ich habe damals eine Ausgabe später Widerspruch eingelegt. Es ging nämlich in meinen Augen nicht um Politik, nicht um die Abscheu vor Staatskunst, sondern es ging um einen Kulturkampf, den Kampf der Westkunst gegen die Ostkunst, der avantgardistischen Nachhut gegen Figürlichkeit und Konkretion, kurz: gegen das Tafelbild. Die an ihr Ende gekommene Moderne sah sich von Malern bedroht, die scheinbar bruchlos an die großen Namen der Gegenständlichkeit anknüpften. 1988 hatte Günter Kunert in der ZEIT eine Polemik gegen die „Sinnlosigkeit der zeitgenössischen Kunst“ geschrieben und festgestellt: „Die Interpretation ist unabdingbar Bestandteil der Werke selber geworden. Sie beweist häufig einen größeren Einfallsreichtum als die interpretierten Objekte selbst, deren Erscheinungsweise oft genug erbärmlich simpel, trostlos, primitiv und unattraktiv ist. Ohne den Interpreten, den bemühten Handlanger des Künstlers, bliebe das Material toter Müll.“
dass er zu Lebzeiten der DDR wegen seiner dissidentischen Qualitäten gelobt wurde. Am sichtbarsten wurde das in der Ausstellung, die Uwe Schneede 1977 im Hamburger Kunstverein arrangierte und wo das Bild Hinter den sieben Bergen eine prominente Rolle spielte. Man verstand es als Verbeugung vor dem Freiheitskampf des Prager Frühlings, was sicherlich keine falsche, aber doch eine sehr verkürzte Deutung ist. Als dann aber die DDR verschied, war dieser dissidentische Bonus erschöpft, und die Maler der so genannten Leipziger Schule konkurrierten nun auf dem freien Markt mit den dort etablierten Künstlern der Westkunst. Das ist der Hintergrund, vor dem es 1994 zum deutschen Bilderstreit kam. Dieter Honisch, Direktor der Berliner Neuen Nationalgalerie, hatte Bilder von Willi Sitte, Werner Tübke, Bernhard Heisig und Wolfgang Mattheuer in eine neue Präsentation gegenwärtiger Kunst aufgenommen und damit Protest geerntet. Er kam von CDU-Mitgliedern des Abgeordnetenhauses, aber auch von Kunstfreunden und Kunstkritikern. Der Vorwurf: Damit werde die Staats- und Auftragskunst der DDR unzulässig nobilitiert, diese Bilder des „Agitprop“ würden „aus ihrer DDR-Geschichtlichkeit entlassen“ – so Hans-Joachim Müller in der ZEIT vom 20. Mai 1994. Ich habe damals eine Ausgabe später Widerspruch eingelegt. Es ging nämlich in meinen Augen nicht um Politik, nicht um die Abscheu vor Staatskunst, sondern es ging um einen Kulturkampf, den Kampf der Westkunst gegen die Ostkunst, der avantgardistischen Nachhut gegen Figürlichkeit und Konkretion, kurz: gegen das Tafelbild. Die an ihr Ende gekommene Moderne sah sich von Malern bedroht, die scheinbar bruchlos an die großen Namen der Gegenständlichkeit anknüpften. 1988 hatte Günter Kunert in der ZEIT eine Polemik gegen die „Sinnlosigkeit der zeitgenössischen Kunst“ geschrieben und festgestellt: „Die Interpretation ist unabdingbar Bestandteil der Werke selber geworden. Sie beweist häufig einen größeren Einfallsreichtum als die interpretierten Objekte selbst, deren Erscheinungsweise oft genug erbärmlich simpel, trostlos, primitiv und unattraktiv ist. Ohne den Interpreten, den bemühten Handlanger des Künstlers, bliebe das Material toter Müll.“
Man muss sich Kunerts polemische Diktion nicht zu eigen machen, aber es ist leicht zu erkennen, dass in seiner Beobachtung der Hauptgrund für die Ablehnung von Malern wie Tübke, Heisig und Mattheuer liegt. Bei Mattheuer ist es vor allem die Tatsache, dass er verständlich und gegenständlich malt. Seine Bilder erzählen Geschichte und Geschichten, sie sind genau im Detail, ihr Raum ist von einem klaren Licht erfüllt, und sie verkünden eine Botschaft. Die Botschaft allerdings ist vieldeutig, das Licht gewittert ins Unheimliche hinüber, und die Geschichten sind nicht auflösbar in Leitartikel. In Mattheuers bilderbuchdeutlichen Bildern steht das Rätsel am Ende, während manche moderne Kunst es an den Anfang stellt. Es gibt minimalistische Gemälde Mattheuers, wo das Sonntagsmalerische sich ins unverhofft Schreckliche öffnet, wo eine irrlichternde Utopie, ein namenloses Jenseits hereinbricht, wo die Landschaft in einer Nacht versinkt, die aufgerissen wird von einem fernen Licht, einem Kometen, einem Gewitter, einem Scheinwerferlicht.
Aber Mattheuer hat sich, und das erst macht ihn zum maßgeblichen Maler, nie mit solchen privaten Phantasmagorien begnügt. Er hat sich immer gesorgt und gekümmert um die Welt, die Gesellschaft, in der er lebte. Das war der Sozialismus – zunächst seine Hoffnung, dann sein Widerpart, dann sein Trauma. Das Schicksal der Menschen war ihm nie egal, und deshalb hat er sich allegorisch und metaphorisch abgearbeitet an den Widersprüchen. Er hätte sie gerne versöhnt, aber er war ein zu störrischer und eigensinniger Mann, um sich einer erpressten Versöhnung zu fügen.
Mit Mattheuer traf also der Maler einer im Westen verdrängten Tradition auf eine ihrerseits erstarrte, akademisch gewordene Moderne. Vielleicht sollte man sich deren Herkunft in Erinnerung rufen: Der Aufstand der Moderne war ein revolutionärer Akt gegen Museumsmief, akademische Erstarrung und bürgerliche Konvention. Über Generationen hinweg tobte die Sezession. Anwälte der Eigentlichkeit beklagten den Verlust der Mitte. Kulturkonservative suchten ihre Felle vor der Flut der Moderne zu retten. Die Pop-art brachte die Entscheidung: Die Moderne hatte sich auf breiter Front durchgesetzt. Sie hing in jeder Studentenbude, passierte jede evangelische Akademie, war marktbeherrschend geworden und in jeder Boutique zu haben.
Je mehr aber das Objekt der Provokation schwand, je weniger gewusst wurde, wovon sich die Sezession abgesetzt hatte, je mehr der künstlerische Dissident zum Strömungsschwimmer wurde, desto mehr brauchte man den Interpreten. Eine Spirale von Feldsteinen, ein Häuflein Blütenstaub, ein Monitor in einem Hügel aus Grassoden, eine lilafarbene und zwei rosafarbene Neonröhren in der Kunsthallenecke: Das musste erklärt werden. So entstand der schwafelnde Schamanismus in der modernen Kunstkritik, den Karl Markus Michel 1990 im Kursbuch bloßgelegt hat.
Die Kunstkritiker haben geholfen, die Moderne durchzusetzen, sie sind mit ihr alt geworden und sie sind die Sieger. Aber in der Kunst zu siegen, heißt zu verlieren. Der westliche Kunstbetrieb hat allzu lange seine Augen vor Mattheuers Bildern verschlossen. Sie entlassen den Kunstfreund aus der Fürsorge des Interpreten, sie sprechen für sich Und das hat sich inzwischen glücklicherweise herumgesprochen. Wer jetzt die große Ausstellungsfläche im Tiefparterre der Hamburger Galerie der Gegenwart besucht, sieht zu seiner Überraschung, dass der neue Museumsdirektor Hubertus Gassner dem Tafelbild wieder einen zentralen Platz eingeräumt hat. Da hängen Bilder von Tübke und Heisig und Neo Rauch, dem legitimen und weithin gefeierten Erben der Ostkunst, und da hängt eben auch der Alte Genosse am Zaun. Ein später, ein verdienter Triumph. Wir müssen gar nicht nachforschen, welche Objekte der alt gewordenen Moderne diesem Auftritt weichen mussten, wir dürfen uns ganz einfach darüber freuen.
Die Rezeption von Kunst ist nie vorhersehbar, und die Kritik ist nicht allmächtig. Und sie ist, auch das soll gesagt sein, am Ende durchaus lernfähig. Wolfgang Mattheuer hat sich bei dem, was er malen wollte und intrinsisch malen musste, nie nach irgendwelchen Vorgaben gerichtet, er war ein unabhängiger Geist, unabhängig auch von Zustimmung oder Konjunktur. Und doch, so glaube ich, hätte er sich sehr darüber gefreut, seinen Alten Genossen in Hamburg hängen zu sehen, allen Besuchern sichtbar.