|
Home - Bilderwelten - Nachruf auf Ingmar Bergman
|
|
Ulrich Greiner Bergman wurde am 14. Juli 1918 in Uppsala geboren, er starb am 30. Juli 2007 auf Fårö. Der folgende Nachhruf erschien in der ZEIT.
Es gab oder gibt Zeitgenossen und Nachfahren wie etwa den Russen Tarkowskij (in dem Bergman einen Gleichgesinnten erblickte), den Griechen Angelopoulos oder den Finnen Kaurismäki, aber das sind versprengte, eigensinnige Helden des alteuropäischen Kinos, die fast nur im engeren Zirkel der Enthusiasten bekannt und von Bedeutung sind, während Bergman damals die Kinos füllte und endlose Debatten nicht nur in den Feuilletons sondern auch an den Tischen und in den Betten auslöste. Wer alt genug ist, wird sich mit gemischten Gefühlen an den Film Szenen einer Ehe (1973) erinnern, der die Familienplanung einer ganzen Generation erschütterte. Was von heute aus betrachtet in diesem oder jenem Fall bedauerlich sein mag, aber Auskunft gibt über die Wucht, mit der Bergmans Filme ins damals noch intakte bürgerliche Milieu einschlugen. Ich erinnere mich an mein erstes dramatisches Kino-Erlebnis. Es war 1963, als wir in der Schule auf Bergmans Schweigen zu sprechen kamen und unser fortschrittlicher katholischer Religionslehrer (ein Priester, der wenig später laisiert wurde) uns empfahl, den skandalisierten Film anzusehen. Er handele von der Abwesenheit Gottes und von der Suche nach ihm. Wir suchten weniger nach Gott als nach jenen ungeheuerlichen Szenen, die wir weder im Kino noch in unserem Leben je gesehen hatten. Zwei Schwestern, die ältere sterbenskranke Ester (Ingrid Thulin) und die jüngere Anna (Gunnel Lindblom) mit ihrem kleinen Sohn, befinden sich auf der Heimkehr von einer Reise und machen Halt im Grandhotel einer namenlosen Stadt, die irgendwo im Balkan zu liegen scheint. Ester wirbt vergeblich um die Zuneigung Annas, die, gepackt von sexueller Begierde, hungrig durch die Straßen streift, einen Mann aufliest und rüde mit ihm kopuliert, während Ester, geschüttelt von Hustenanfällen, auf dem Hotelbett sich selber erbärmlich zu befriedigen sucht. Diese Bilder verstörten und empörten die Öffentlichkeit in einem heute unvorstellbaren Ausmaß, aber die Verstörung hatte ihren Grund weniger (was nicht allen Zuschauern bewusst Die Liebe, so erfahren wir, ist nicht im Eros, nicht in den Worten, sondern in der grundlosen, selbstlosen Zuwendung. Es ist das Hohelied der Liebe aus dem Ersten Korintherbrief, das der Pastorensohn Bergman hier im Sinn hat. Dort steht auch der Satz „Wir sehen jetzt wie in einem Spiegel ein dunkles Bild; dann aber von Angesicht zu Angesicht“, der einem der radikalsten Filme Bergmans den Titel gibt. Wie in einem Spiegel (1961) spielt auf einer einsamen Insel, wo vier Menschen Ferien machen, ein älterer Schriftsteller, sein halbwüchsiger Sohn, seine Tochter und deren Ehemann. Die junge Frau (Harriet Andersson) leidet offenbar unter Schizophrenie, aber sie ist die einzige, die der Sprachlosigkeit und der im Diesseits verkrampften Hoffnungslosigkeit der anderen entkommt. In einem leeren Zimmer des nur teilweise bewohnten Hauses kommuniziert sie mit dem Jenseits und hört Stimmen. Ihr Mann (Max von Sydow), der Arzt ist, ruft den Notdienst, und man sieht hinter dem verklärten Gesicht der jungen Frau, die mit Gott spricht, durch das Fenster den landenden Hubschrauber, dessen Rotoren die Stille zerreißen. Da bricht sie zusammen. Gott sei ihr erschienen, stammelt sie, aber dann sei es nur eine schreckliche Spinne gewesen. Als man sie abtransportiert, stehen Vater und Sohn am Fenster und blicken auf ein Meer, dessen Grau mit dem des Himmels verschmilzt. Der Sohn (Lars Passgard), noch wie zertrümmert von dem Inzest, zu dem die Schwester ihn kurz davor verführt hat, fragt den Vater nach einem Weg aus der Sinnlosigkeit, und der Vater (Gunnar Björnstrand) spricht zum ersten Mal wirklich mit ihm. Er übersetzt den Korintherbrief in die Gegenwart und sagt: Der einzige Weg ist die Liebe. Ingmar Bergman hat sich Zeit seines Lebens mit der Frage nach Gott und der Theodizee, mit der Unmöglichkeit und der Notwendigkeit der Liebe herumgeschlagen. Noch in einem seiner heitersten Filme, im operettenhaften Lächeln einer Sommernacht (1955) liegt der Kuscher mit dem Dienstmädchen auf der Wiese, schwenkt nach gehabtem Vergnügen den Bierkrug und sagt: „Wir wünschen uns die Liebe, rufen, bitten, schreien nach ihr, glauben sie zu besitzen, lügen sie herbei, aber wir haben sie nicht.“ Wenn wir aber die Liebe nicht haben, bleibt nur die Hoffnung auf Gott. Dessen Ferne zeigt der Film Licht im Winter (1963). Der Landpfarrer (Gunnar Björnstrand), der dem lebensmüden, an der Gemeinheit und Sinnlosigkeit der Welt verzweifelnden Fischer (Max von Sydow) einen Weg weisen soll, weiß keinen und ist selber verzweifelt. Wenn es Gott nicht gäbe, so denkt er, wäre alles insofern einfacher, als man dann das Elend nicht mit seiner Existenz in Einklang bringen müsste. Aber Bergmans Filme wären nicht so bedeutend, wenn sie nicht beides hätten: Die Radikalität der Fragestellung und die Radikaltät der Form. Lange Passagen von „Licht im Winter“ (eigentlich: „Abendmahlsgäste“) spielen in einer Kirche, und wir erleben den Gottesdienst in Echtzeit. Er findet in der letzten Szene vor nahezu leeren Bänken statt, und die Entschiedenheit mit der sich der Film auf die heilige Handlung konzentriert, macht die Abwesenheit der Gläubigen und des Glaubens umso sichtbarer. Wie in einem Spiegel spielt ausschließlich auf einer kargen, menschenleeren Insel, und wir erleben nur den Wechel des Lichts auf dem Wasser und den Felsen, die Begegnungen, Gespräche, die Konflikte der vier Personen. Die Offenheit der Landschaft lässt die Menschen noch verlorener erscheinen. Im Schweigen, das mit einem Minimum an Dialogen auskommt, bewegen wir uns ausschließlich im eingesperrten Bezirk eines Zugabteils, eines Hotels, einer engen Straße, eines Cafés, eines Kinos. Die klaustrophobische Szenerie erzeugt wie von selbst die Überschreitung. Sie zeigt sich im sexuellen Exzess und in der wortkargen, dafür umso wirkungsvolleren verbalen Aggression. Unvergesslich der Tanz der Liliputaner mit dem kleinen Jungen, dem sie ein Mädchenkleid angezogen haben. Die Szenen einer Ehe wiederum bestehen fast ausschließlich aus Dialogen, und das pausenlose Gerede entlarvt nur die Ohnmacht der Worte angesichts der Fliehkraft des Liebe, die von keiner Moral und keiner guten Absicht eingeholt werden kann. Kein anderer Regisseur hätte den Mut gehabt, mit einem derart geringen dramaturgischen Vorrat an den Start zu gehen, und bei jedem anderen hätte diese Radikalität der Beschränkung in schierer Ödnis geendet. Das Erstaunlichste ist aber, dass man Bergmans Filmen manches vorwerfen kann (das Pathos der Sinnlosigkeit etwa), aber niemals Langeweile. Vielleicht liegt das an seiner reichen Erfahrung als Theaterregisseur. In der Tat haben die filmischen Dialoge zuweilen etwas theaterhaft Zugespitztes, und seine Fähigkeit der Schauspielerführung ist legendär. Aber der Hauptgrund für die nicht nachlassende Wirkungsmacht seiner Filme liegt gerade darin, dass er den Zuschauer nicht gefällig umworben, sondern gnadenlos und unerschrocken zum Teilnehmer einer Expedition gemacht hat – einer Expedition ins Innere des Bergmanschen Kosmos, und der war, obwohl gespeist aus höchst persönlichen Erfahrungen, der Kosmos einer bestimmten bürgerlichen Welt mit ihrer Sehnsucht nach Liebe und Glück, ihrer freiwilligen Knecntschaft im Dienste der Arbeitsethik und ihrer verzweifelten Angst vor dem Tod. Das ist, wie man leicht sehen kann, kein schwedisches Problem allein. Und indem Bergman die Träume und Alpträume der Erwachsenen in geradezu unendlicher Variation bebildert, selbstversessen und dadurch beispielhaft, hat er auf seine Weise geleistet, was Astrid Lindgren für die Kinder getan hat: Er hat uns Geschichten geben, in denen wir uns wiederfinden und so entlasten können. Wahr ist aber auch, dass es dafür einer Fähigkeit zur Kontemplation bedarf, die in unserem beschleunigten Zeitalter seltener geworden ist. Es sind zumeist ernste, grüblerische Geschichten, denn Bergman war auch darin Protestant, dass er glaubte, die möglichst radikale Selbsterforschung führe zur Läuterung und zur Erkenntnis. Das ist im Grunde ein optimistisches Programm, jedenfalls ein aufklärerisches. Dass es sehr oft misslingt, ist noch kein Einwand dagegen. Bergman war kein Romantiker. So finster seine Film oft sind – dunkel sind sie nie. Und so sehr sie sich mit dem Rätselwesen Mensch abmühen – rätselhaft sind sie nie. In einem seiner großartigsten Filme (Wilde Erdbeeren, 1957) gerät der 78jährige Wissenschaftler Eberhard Isak Borg (Victor Sjöström) unversehens in die Welt der Träume, Wer diese Bilder gesehen hat, wird sie nicht vergessen. Sie klingen beim Nacherzählen theatralisch-effektvoll. Bergman hat Effekte nie verschmäht, sondern mit geradezu kaltem Kalkül in die hoch effiziente Dramaturgie seiner Selbst- und Welterforschung eingebaut. Im weiteren Verlauf des Films wird er die Traumsequenzen derart steigern, dass sie realistischer erscheinen als die realen Szenen, die ihrerseits etwas Traumhaftes gewinnen. Ingmar Bergman hat sein filmisches Werk als ein ästhetisches Projekt begriffen, das er mit Fanny und Alexander (1982) krönen wollte. Dieser wohl schönste Film ist tatsächlich eine Bergman war von rastloser Produktivität erfüllt, die Zahl seiner Filme, seiner Theaterinszenierungen, seiner Drehbücher, die zum Teil hohe literarische Qualität haben, ist unfassbar. Nicht wenige der Schauspieler und Filmleute, mit denen er zusammengearbeitet hat, sind durch ihn berühmt geworden, und viele Regisseure haben von ihm gelernt. Die Filmgeschichte wäre ohne ihn eine andere, und es ist gut möglich, dass sich unsere von einem wachsenden Bedürfnis nach Sinn erfüllte Zeit auf sein Werk wieder besinnt. In seinem Haus auf der Insel Farö sei ihr Vater friedlich eingeschlafen, sagte die Tochter Eva Bergman. Wer seine Lust am Widerspruch – und sein Leiden daran – kannte, wird dies als tröstliche Nachricht empfinden.
|
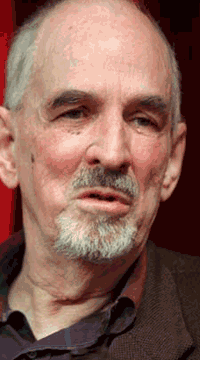 Ingmar Bergman, einer der größten Regisseure, die der Film je gesehen hat und der jetzt im Alter von 89 Jahren gestorben ist, war ein Mann des vergangenen Jahrhunderts. Obgleich die Geschichte der Filmkunst ohne ihn anders verlaufen wäre – denn er hat die Kinogänger, die Schauspieler, die Regisseure der Epoche geprägt –, so ist doch die jüngste Zeit über ihn hinweggegangen oder besser hinweggerast. Denn der Film, verstärkt durch die computergestützten Techniken, hat der Beschleunigung unserer Epoche willfährig Ausdruck gegeben, hat sie seinerseits vorangetrieben. Die insistierende Sinnsuche aber, die daseinsergründende religiöse Intensität Bergmans, dieser existenzielle Zorn, dieser Hass gegen ein protestantisch tüchtiges Bürgertum, dargestellt mit einem immer höher entwickelten Sinn für Stil und Form – das hat man seit Bergman nicht mehr gesehen.
Ingmar Bergman, einer der größten Regisseure, die der Film je gesehen hat und der jetzt im Alter von 89 Jahren gestorben ist, war ein Mann des vergangenen Jahrhunderts. Obgleich die Geschichte der Filmkunst ohne ihn anders verlaufen wäre – denn er hat die Kinogänger, die Schauspieler, die Regisseure der Epoche geprägt –, so ist doch die jüngste Zeit über ihn hinweggegangen oder besser hinweggerast. Denn der Film, verstärkt durch die computergestützten Techniken, hat der Beschleunigung unserer Epoche willfährig Ausdruck gegeben, hat sie seinerseits vorangetrieben. Die insistierende Sinnsuche aber, die daseinsergründende religiöse Intensität Bergmans, dieser existenzielle Zorn, dieser Hass gegen ein protestantisch tüchtiges Bürgertum, dargestellt mit einem immer höher entwickelten Sinn für Stil und Form – das hat man seit Bergman nicht mehr gesehen. war) in der brutalen Sexualität als in der durch keine Musik oder Dialoge gemilderten Kälte der Begegnungen, eine Kälte, die von der fühlbar auf den Straßen lastenden Hitze noch vestärkt wird. Als der Zug der Reisenden in die Stadt rollt, sieht man auf dem Gegengleis Güterzüge, die Kriegsgerät transportieren, und einmal, als Anna, schlaflos vor Hitze und unerfülltem Verlangen, aus dem Hotelfenster blickt, schiebt sich ein Panzer durch die nächtliche Straße, und das dröhnende Scheppern der Ketten erfüllt den sonst fast tonlosen Film wie das Fanal der Hölle. Dagegen setzt Bergmann Signale der Hoffnung, Zeichen der Liebe. Caritas spricht aus der rührenden Hilfsbereitschaft des alten Zimmerkellners, der die kranke Ester versorgt. Sie verständigen sich mit Handzeichen, da ihnen die Sprache des anderen fremd ist.
war) in der brutalen Sexualität als in der durch keine Musik oder Dialoge gemilderten Kälte der Begegnungen, eine Kälte, die von der fühlbar auf den Straßen lastenden Hitze noch vestärkt wird. Als der Zug der Reisenden in die Stadt rollt, sieht man auf dem Gegengleis Güterzüge, die Kriegsgerät transportieren, und einmal, als Anna, schlaflos vor Hitze und unerfülltem Verlangen, aus dem Hotelfenster blickt, schiebt sich ein Panzer durch die nächtliche Straße, und das dröhnende Scheppern der Ketten erfüllt den sonst fast tonlosen Film wie das Fanal der Hölle. Dagegen setzt Bergmann Signale der Hoffnung, Zeichen der Liebe. Caritas spricht aus der rührenden Hilfsbereitschaft des alten Zimmerkellners, der die kranke Ester versorgt. Sie verständigen sich mit Handzeichen, da ihnen die Sprache des anderen fremd ist.  die ihn unnachgiebig vor die Frage stellt, welchen Sinn sein bisheriges Leben gehabt hat, ob es gut und richtig war. Sein erster Traum zeigt ihn, wie er durch eine leere Straße mit vernagelten Schaufenstern und brüchigen Fassaden geht. Er blickt auf seine Taschenuhr: Sie hat plötzlich keine Zeiger mehr. Suchend schaut er sich um, findet eine Uhr an der Hauswand und bemerkt zu seinem Entsetzen, dass auch die keine Zeiger hat. Er geht weiter und stößt von hinten auf einen Passanten. Er tippt ihm auf die Schulter, um nach der Zeit zu fragen. Der Mann dreht sich um, zeigt ein furchtbar entstelltes Gesicht, stürzt tot hernieder, Blut fließt in den Rinnstein. In diesem Augenblick ertönt grässlicher Lärm, ein Leichenwagen kommt ihm entgegen, bleibt an der Laterne hängen, ein Rad löst sich, rollt auf ihn zu, er kann sich gerade noch retten. Die Pferde ziehen an, der Sarg rutscht von der Kutsche, kommt vor ihm zu liegen, er beugt sich nieder, ein Hand ragt heraus, ergreift ihn, zieht ihn herab, und jetzt sieht sich selber als Toten im Sarg.
die ihn unnachgiebig vor die Frage stellt, welchen Sinn sein bisheriges Leben gehabt hat, ob es gut und richtig war. Sein erster Traum zeigt ihn, wie er durch eine leere Straße mit vernagelten Schaufenstern und brüchigen Fassaden geht. Er blickt auf seine Taschenuhr: Sie hat plötzlich keine Zeiger mehr. Suchend schaut er sich um, findet eine Uhr an der Hauswand und bemerkt zu seinem Entsetzen, dass auch die keine Zeiger hat. Er geht weiter und stößt von hinten auf einen Passanten. Er tippt ihm auf die Schulter, um nach der Zeit zu fragen. Der Mann dreht sich um, zeigt ein furchtbar entstelltes Gesicht, stürzt tot hernieder, Blut fließt in den Rinnstein. In diesem Augenblick ertönt grässlicher Lärm, ein Leichenwagen kommt ihm entgegen, bleibt an der Laterne hängen, ein Rad löst sich, rollt auf ihn zu, er kann sich gerade noch retten. Die Pferde ziehen an, der Sarg rutscht von der Kutsche, kommt vor ihm zu liegen, er beugt sich nieder, ein Hand ragt heraus, ergreift ihn, zieht ihn herab, und jetzt sieht sich selber als Toten im Sarg. Art Abschluss, auch wenn er danach noch einige Filme gedreht hat (etwa Sarabande 2003). Dieser Abschluss strahlt, anders als fast alle seine übrigen Filme, eine heitere Versöhnlichkeit aus, er ist eine Synthese aller Motive, die sein Leben bestimmt haben. Die in einer schwedischen Kleinstadt um 1907 spielende Familiengeschichte ist auch eine Liebeserklärung an das Theater und eine spöttisch-respektvolle Verneigung vom dem Bürgertum. Aber Bergman wäre nicht Bergman, wenn er nicht auch hier aus den Bildern eines bukolischen Landlebens, fröhlicher Feste und deftiger Affären die Nachtmahre eines fanatischen Protestantismus aufsteigen ließe. Was den beiden Kindern im Palast des Bischofs widerfährt, ist ein langer, böser Traum, aber er bleibt ein Traum und löst sich auf in einem fröhlichen Familienfest. Der letzte Satz, den die alte Frau Ekdahl in ihrem Lehnstuhl leise vor sich hinliest, stammt von Bergmans geliebtem Strindberg: „Alles kann geschehen, alles ist möglich und wahrscheinlich. Zeit und Raum existieren nicht. Auf dem Grund der Wirklichkeit webt die Einbildungskraft neue Muster.“
Art Abschluss, auch wenn er danach noch einige Filme gedreht hat (etwa Sarabande 2003). Dieser Abschluss strahlt, anders als fast alle seine übrigen Filme, eine heitere Versöhnlichkeit aus, er ist eine Synthese aller Motive, die sein Leben bestimmt haben. Die in einer schwedischen Kleinstadt um 1907 spielende Familiengeschichte ist auch eine Liebeserklärung an das Theater und eine spöttisch-respektvolle Verneigung vom dem Bürgertum. Aber Bergman wäre nicht Bergman, wenn er nicht auch hier aus den Bildern eines bukolischen Landlebens, fröhlicher Feste und deftiger Affären die Nachtmahre eines fanatischen Protestantismus aufsteigen ließe. Was den beiden Kindern im Palast des Bischofs widerfährt, ist ein langer, böser Traum, aber er bleibt ein Traum und löst sich auf in einem fröhlichen Familienfest. Der letzte Satz, den die alte Frau Ekdahl in ihrem Lehnstuhl leise vor sich hinliest, stammt von Bergmans geliebtem Strindberg: „Alles kann geschehen, alles ist möglich und wahrscheinlich. Zeit und Raum existieren nicht. Auf dem Grund der Wirklichkeit webt die Einbildungskraft neue Muster.“